Lieblings Gedichte
Robert Walser, 1878-1956
Beiseit
Ich mache meinen Gang;
Der führt ein Stückchen weit
und heim; dann ohne Klang
und Wort bin ich beiseit.
VII, 22 (1899)
Frühling
Es passt wohl jedem, dass es wieder
warm ist, und dass die Fenster offen sind
und Frühlingswind ins Zimmer weht.
Vermutlich nimmt es niemand übel,
dass nun die Wälder wieder grünen
und Wiesen voller Gräser sind
und Vögel in den Bäumen singen
und Veilchen aus der Erde blühn.
Vielhunderttausend grüne Blätter!
Der Frühling ist ein Feldmarschall,
dem alle Leute gerne gönnen,
dass er die Welt bezwingt.
Siegreich durch alle Länder sieht sich
ein Blütenmeer. Die Gegenden
sind weiss, als wolle eine
Prinzessin angefahren kommen. O,
so zart ist alles, viel zu zart,
als dass es Dauer haben könnte.
Der Frühling ist nur kurz, was red’ ich
für altgebacknes Zeug. Das weiss
ja jeder. Kinderspiel im Freien!
«Ist’s möglich?» fragen sich die Menschen
und schauen sich an und lächeln. Einer
weint gar vor Freude, Schwierig ist’s.
In all das Herrliche zu sehn
und nicht gerührt zu sein. Der Frühling
war oft schon da und ist doch jedes
mal neu und immer wieder jung.
Das Alte geht mit Jungem. Gatte
mit Gattin. Kleines mit dem Grossen,
und alle sind verbrüdert: Völker
mit Völkern. Zur Geliebten schleicht
der Liebende. Er singt. Nur dem,
der wahrhaft liebt, gelingt ein Lied.
Küssen und Träumen. Unweit steht
mit finstrer Mien’ an einer Mauer
der Lebensernst; und wer an ihm
vorübergeht, muss zittern.
VII 149 (1919)
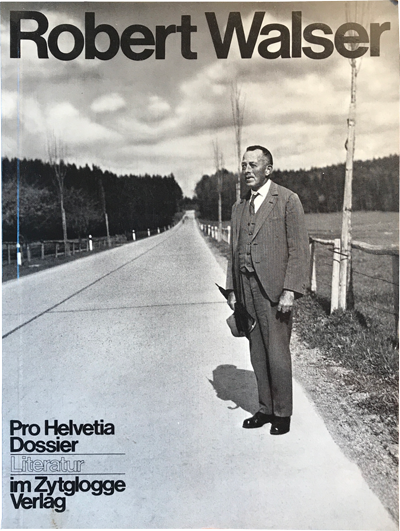
Dieter Leisegang, 1941-1973
Einsam und allein
Einsam ist ja noch zu leben
Hier ein Ich und dort die andern
Kann durch die Alleen wandern
Und auf Aussichtstürmen schweben
Einsam ist noch nicht allein
Hat noch Augen, Ohren, Hände
Und das Spiel der Gegenstände:
Und die Trauer, da zu sein
Doch allein ist alles ein
Ist nicht da, nicht dort, nicht eben
Kann nicht nehmen oder geben
Leergelebt und allgemein
Lauter letzte Worte
1973
Vergangenheiten
Eben, beim Ausziehn, zufällig aus dem Fenster blickend –
Seh’ ich das Treppenhaus gegenüber erleuchtet, einen
jungen Mann, neunzehn, zwanzig vielleicht auf den Stufen
sitzen vor einer Wohnungstür, so, als käme er nicht
hinein, jetzt, vier Uhr morgens, weil seine Mutter
die Klingel nicht hört. – Im selben Haus, Altbau, Speyerstrasse,
wohnte vor fünfzig Jahren mein Vater zusammen mit
seiner Mutter (er zeigt mir’s von hier oben einmal,
als er noch lebte). Auch ich hab’ schon ähnlich
gesessen, heimkommend von Freunden, und jedenfalls er,
gesessen dort drüben, müde, den Kopf in die Hände gelegt,
in der Sicherheit von neunzehn, zwanzig, dem wirren Alter,
das man erträgt, weil der junge Körper klüger ist als aller
Verstand und richtig steuert dessen Sturm, die Qual
der Gedanken. Also gesessen in der Sicherheit von
Hunger und Neid, obdachlos, mit der Wut
hinauszuwollen aus dem einfachen Elend dieser Jahre,
die jetzt vergangen sind,
meinem Vater und mir, die uns vergangen sind vor
lauter Tod. Da öffne ich mein Fenster und sag’s
in die Nacht hinaus: ...
Heraklit Fragment 122
Wohl immer malte ein kleiner Tod, ein
Kindersterben
Schatten in meine Augen
Besinn ich mich
Hinter den Scheiben sitzend am Abend –
Wenn aus der Stadt und drüben
Über dem Fluss
Der Oktober raucht
Fällt mir ein: dass meine Mutter
(einmal vor langer Zeit)
Lächelnde Hände hatte
(2.10.1967)
Selbstportrait mit Zigarette
Im Grase am Fluss
Unter der Eisenbahnbrücke
Sitz’ ich
Inhalierend Virginias
Riesige Felder
(27.8.1960)
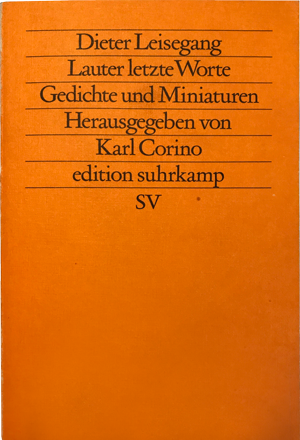
Hilde Domin, 1909-2006
Nur eine Rose als Stütze
Ziehende Landschaft
1968
Man muss weggehen können
und doch sein wie ein Baum;
als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft und wir ständen fest.
Man muss den Atem anhalten,
bis der Wind nachlässt
und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt,
bis das Spiel von Licht und Schatten,
von Grün und Blau,
die alten Muster zeigt
und wir zuhause sind,
wo es auch sei,
und niedersitzen können und uns anlehnen,
als sei es an das Grab
unserer Mutter.

Theodor Kramer, 1897-1958
Kleines Café an der Lände
Kleines Café an der Lände,
bröckelnder Firnis und Kitt,
alles für ihn ist zu Ende,
wann dich der Stammgast betritt.
Nichts ist für ihn mehr vorhanden
als die gepolsterte Bank,
draussen die Barken, die landen,
drinnen der Pfeifengestank.
Kümmelbestreut sind die Kipfel,
stark ist der heisse Kaffee;
strahlend im bläulichen Zipfel
sagen die Wolken ade.
Möge die Welt draussen warten:
Schein ist sie, nichts hier ist wahr
als nur die Regeln der Karten
und das Geschick im Billard.
Hier ist die Zeit nicht bemessen,
Träger, hier trägst du nicht mehr,
Kind, dein Geschäft ist vergessen,
Stelzfuss, dein Gang ist nicht schwer.
Still schlägt die Flut an die Lände;
reicht ihr im Schwinden des Lichts
einmal dem Dämmern die Hände,
zieht es am End euch ins Nichts.
Unlängst sass ich in verteckter Schenke
Unlängst sass ich in versteckter Schenke,
brach zum Apfelwein das mürbe Brot,
roch das Holz der blankgewetzten Bänke,
und ich wusste jäh; das ist der Tod.
Unterm Laub am altgewohnten vollen
Glas mich freuen darf ich fürder nicht;
denn sich freuen, das heisst Bleibenwollen,
und von hier zu gehen ist meine Pflicht.
Hart ist es für mich , mich zu vermauern,
denn es ist noch alles ungewiss,
und es kann noch viele Tage dauern,
grosser Einsamkeit und Finsternis.
Gut ist Härte, gut ist Freude, beides
tät mir bitter not, so wahr ich bin;
gross ist heut das Mass gemeinen Leides,
und das Leben drängt nach einem Sinn.
Stärker wär’s, die Stunde so zu nehmen,
wie sie fällt, bevor das Licht erlischt;
denn das Herbe mit dem Angenehmen
ist in mir absonderlich gemischt.
So geartet, wie ich bin, nicht minder,
hab ich mich zu retten in die Welt,
wo wir alle wieder Gottes Kinder
sind und bleiben, wenn es ihm gefällt.
Die alten Geliebten
Die alten Geliebten, mit denen ich lag,
gestoben, verschollen, vergessen vor Tag,
sie sind nun auf einmal mir nahe bei Nacht,
als hätt ich mit ihnen nicht Schluss längst gemacht.
Die erste war schüchtern und kindlich und mild,
die zweite war stolz und war schön wie ein Bild;
ich konnte sie beide nicht richtig verstehn,
drum lassen so oft sie bei Nacht sich nun sehn.
Die dritte war Freundin für Weinland und Flur,
die vierte gab Lust mir wie nie eine Hur;
sie gingen von mir, als sich wandte mein Glück,
drum kommen im Elend zu mir sie zurück.
Ich sag, was ich alles zu sagen vergass,
ich rieche das Sofa und rieche da Gras;
ich liege mit ihnen, wie niemals ich lag;
bald wird es stets Nacht sein und niemals mehr Tag.

Rainer Brambach, 1917-1983
Tagwerk
Der Fremde
Der mich nach dem Weg fragte,
kam aus Griechenland.
Argos, Chios, Athenai.
Der Weg zum Badischen Bahnhof
war schwer zu beschreiben.
Ich erinnerte ihn an die Odyssee.
Er zog seinen Hut, in den Regentropfen
glänzten Delphine,
Silber.
Zwang mich die Einsamkeit
Auf den Stoppelfeldern von Sonthofen
Zwang mich die Einsamkeit jäh
zu lautem Sprechen, zu Gemurmel
Fremder Verse, aus Ackerstaub hergeweht.
Krähen, Luftgewichte am Gefieder,
langsam vor Kieferngruppen, und
weit hinten im Dunst Kamine,
Zeigfinger für Fleiss und Wohlstand.
Der Pfad führt – Land afrikanisch trocken –
Zum Mittelpunkt der Welt. Oh Licht
und Ockerwoge im reifen Roggen.
Die flüchtigen Beduinenschatten
an Garbenzelten vergesse ich nicht.
Bericht aus dem Garten
Mit den feurigen Offenbarungen
von Rosen
zieht der Mittag in das Haus ein.
Im Esszimmer wird es still
Für die Zeit,
bis das Fleisch verteilt
und die Gläser ausgetrunken sind.
Draussen wirft das Spalier seinen Schatten
auf den ruhenden Gärtner.
Er wird niemals erfahren,
was der Nussbaum verschweigt,
der am Nachmittag fallen muss.
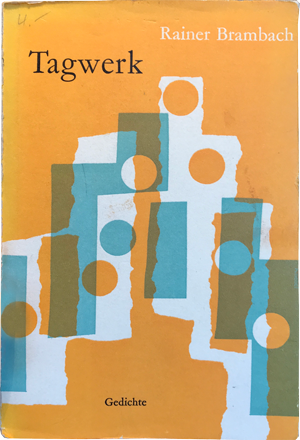
Walter Gross, 1924-1999
Mittag
Weisser Staub –
Zerglühende Sonne im Stein –
Ein heisser Wind trocknet
Die nassen Krüge auf dem Hofplatz
Des Töpfers, lastet auf den gehäuften
Mandeln unter den Ölbäumen
Mit den winzigen Schatten.
Gross wird die Stille
In der erstarrten Echse,
Der stumm Gebäumten.
Die hohen Fruchtstände der Agaven
Zerbrechen die zitternde Haut
Des Himmels und unterm Fuss
Knirschen die harten, schwarzen
Leiber der Falter, es zerspringt
Das stürzende Licht in den Adern
Ihrer glasigen Flügel.
In glühendem Rot stirbt hinter Lidern
Das Rastlose im Menschen
Und Vergessen wird tieferes Erinnern.
In dieser Stunde wächst im feurigen, hellen
Innern der Feigen die ganze Süsse und ist
Irgendwo in verhängten Zimmern der nackte Schlaf
Von Frauen neben handgrossen,
Zerteilten Früchten,
Die vor Feuchte quellen.

Ingeborg Bachmann, 1926-1973
An die Sonne
Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht,
Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht,
Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen
Und zu weit Schönrem berufen als jedes andre Gestirn,
Weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne.
Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat
Und beendet, am schönsten im Sommer, wenn ein Tag
An den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel
Über dein Aug ziehn, bis du müde wirst und das letzte verkürzt.
Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier,
Du erscheinst mir nicht mehr, und die See und der Sand,
Von Schatten gepeitscht, fliehen unter mein Lid.
Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt,
Dass ich wieder sehe und dass ich dich wiederseh!
Nichts Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein ...
Nichts Schönres als den Stab im Wasser zu sehn und den Vogel oben,
Der seinen Flug überlegt, und unten die Fische im Schwarm,
Gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht,
Und den Umkreis zu sehn, das Geviert eines Felds, das Tausendeck meines Lands
Und das Kleid, das du angetan hast. Und dein Kleid, glockig und blau!
Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen,
Blau der Fernen, der Zonen des Glücks mit den Wettern für mein Gefühl,
Blauer Zufall am Horizont! Und meine begeisterten Augen
Weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund.
Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewundrung gebührt,
Drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht,
Weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir einen Narren sucht,
Sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst
Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen.

